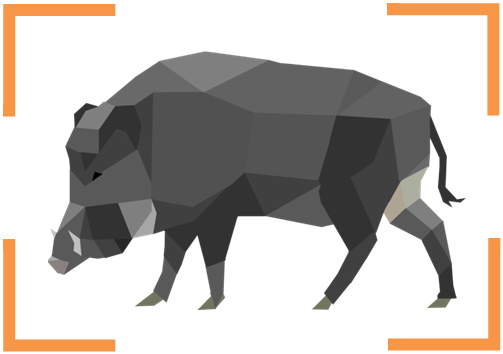Alfred-Hess-Straße 8, 99094 Erfurt
Tel.: 0361 26253600
Fördermöglichkeiten für Thüringer Jäger
ASP-Helferabfrage
Mithilfe im Seuchenfall wird erbeten um Einsatzkräfte bei Suche nach Kadavern durch Ortskenntnisse zu unterstützen
Schulung Saufang
Schulungsveranstaltungen zur Erlangung der Sachkenntnis zum sach- und tierschutzgerechten Einsatz von Saufängen
Beratung zur Anlage von Jagdschneisen
Beratung von Landwirtschaftlichen Betrieben und Jägern zur Förderung der Anlage von Bejagungsschneisen. Ziel ist die Intensivierung der Jagd auf Schwarzwild in der Feldflur
Förderung der Anschaffung von Jagdhunde- und Hundeführerschutzkleidung
Förderzeitraum ist abgelaufen
DROHNEN IM JAGDLICHEN EINSATZ
Sie benötigen Unterstützung bei der Schwarzwildbejagung aus der Luft?
Schwarzwild- Kompetenzzentrum Thüringen
Alfred-Hess-Str. 8
99094 Erfurt
Bürozeiten
Mo-Fr – 7:30 – 16:00
Freitag – 7:30 – 15:00
Informationen zur ASP
Projekte
Projektfinanzierung
Das Schwarzwild-Kompetenzzentrum wird durch das Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie, Naturschutz und Forsten (TMUENF) aus Mitteln des Landes Thüringen zur Vorbeugung gegen die Tierseuche Afrikanische Schweinepest finanziert.
Projekte des SKT
Die Projekte des Schwarzwild-Kompetenzzentrums haben zum Ziel, präventiv gegen die Afrikanische Schweinepest vorzugehen. Hierzu werden Maßnahmen entwickelt, die Thüringer Jäger/-innen bei der Reduktion der Schwarzwildbestände unterstützen. Die Verringerung der Wildschweinpopulation trägt dazu bei, lokale Übertragungswege zu unterbrechen, einer Ausbreitung der Seuche entgegenzuwirken und das Risiko einer Weiterverbreitung zu mindern.
Die Maßnahmen werden in folgende Gruppen eingeteilt. Zur Umsetzung der einzelnen Projekte arbeitet das SKT mit verschiedenen Partnern zusammen, die die Umsetzung der Maßnahmen begleiten:
Informationen & Schulung
- ASP-Informationen für Jäger (ASP-Fibel)
- ASP-Informationen für Jagdgenossen
- Presseinformationen
- ASP-Helferabfrage Abfrage Helfer ASP
- Schulung zu Jagdmethoden und Jagdsicherheit + Schießtraining
Verbesserung Jagdmethoden & Jagdsicherheit
- Jagdmethode Saufang mehr Informationen
- Ersthelfer (Notversorgung) für Jagdhunde
- Schutzkleidung für Jagdhunde und Hundeführer
- Lehrfilme zu Jagdmethoden/-sicherheit und Wildbret zur Infothek
- „Vom Tierarzt zum Jäger“
Verbesserung Vermarktung & Marketing Wildfleisch
- Wildfleisch-Werbung Thüringer Wild
Erprobung Suchmethoden
- Erprobung von Drohnentechnik
- Ausbildung von Kadaversuchhunden
Informationen zum Schwarzwild
Allgemeines
Das Wildschwein (lat. Sus scrofa) gehört zu der Familie der Altweltschweine oder Echten Schweine (Suidae) und ist die Stammform eines unserer wichtigsten Haustiere, dem Hausschwein.
Es kommt in ganz Europa sowie in weiten Teilen Nordafrikas und Westasiens vor. Sein ursprüngliches Verbreitungsgebiet reicht von Westeuropa bis Südostasien. Durch Aussetzen von Tieren kommen Wildschweine heute aber auch in Nord- und Südamerika sowie in Australien vor.
Wildschweine sind nicht nur urig und wehrhaft, sondern vor allem sehr anpassungsfähig. Das machte sie zum Gewinner in unserer Kulturlandschaft. Durch milde Winter, Futter im Überfluss und viele neue Verstecke durch den zunehmenden Maisanbau haben die schlauen Sauen ihre Population in den vergangenen Jahrzehnten vervielfacht. Doch auch die Konflikte mit dem borstigen Allesfresser nehmen zu.
MERKMALE
Wildschweine sind unverwechselbar: Ihre gedrungene Statur, ihr borstiges Fell und ihr ausgeprägter Rüssel sind typisch für die Urform unserer Hausschweine. Andere Eigenschaften wie ihr besonderes Riechvermögen sieht man ihnen nicht auf den ersten Blick an.
FELL UND SCHILD
Neugeborene Frischlinge haben ein hellbraunes Fell mit gelblichen Längsstreifen. Nach drei bis vier Monaten verlieren sie diese Streifen und bekommen ein bräunliches Jugendfell. Vor dem Winter wachsen Wildschweinen lange, dunkelgraue bis schwarze und borstige Deckhaare und kurze feine Wollhaare, zwischen denen winzige Luftkammern den Körper vor Auskühlung schützen. Keiler haben am Rumpf unterhalb des Fells eine deutliche Hautverdickung aus Bindegewebsfasern – das sogenannte Schild – das sie bei Kämpfen in der Paarungszeit vor schweren Verletzungen schützt.
Lebensraum
Schwarzwild lebt bevorzugt in unterholzreichen Laub- und Mischwälder mit ausreichendem Wasservorkommen, aber auch, sofern ausreichend Deckung vorhanden ist, auf offenen Feldfluren. Sobald die Feldfrüchte zur Aussaat gebracht werden, erweitert sich sein Lebensraum. Schwarzwild ist sehr anpassungsfähig und kommt als Kulturfolger zunehmend auch in Siedlungsgebieten vor (z.B. Schwarzwildvorkommen in Großstädten wie Berlin).
Die wichtigsten Anforderungen/Ansprüche von Schwarzwild an dessen Lebensraum sind:
- genügend Deckung für Schlafplätze und zum Bau von Wurfkesseln,
- Verfügbarkeit von ausreichend quantitativer wie auch qualitativer Nahrung und
- Vorhandensein von Wasserstellen und Schlammlöchern zum Schöpfen und Suhlen.
In Thüringen kommt das Schwarzwild inzwischen flächendeckend bis in die Kammlagen des Thüringer Waldes vor. Einige wenige vom Schwarzwild gemiedene Gebiete sind intensivst genutzte landwirtschaftliche Nutzflächen des Erfurter Beckens.
Nahrung
Wildschweine sind Allesfresser, die sich überwiegend von energiereicher pflanzlicher Nahrung ernähren. Neben ihren natürlichen Nahrungsquellen, wie Eicheln und Bucheckern, nehmen sie auch landwirtschaftlich genutzte Felder mit Getreide, Mais, Raps und Kartoffeln an. Sie sind aber auch in der Lage, mit weniger günstiger Nahrung, wie Wurzeln, Knollen und Gras, auszukommen.
Das Schwarzwild braucht zusätzlich auch tierisches Eiweiß. Dies nimmt es überwiegend durch den Verzehr von Regenwürmern, Engerlingen, Schnakenlarven und Ameisenpuppen auf. Nicht selten werden auch Kleinsäuger, wie Mäuse oder Fallwild gefressen.
Da Wildschweine bei der Nahrungssuche in den Wäldern durch Umbrechen der obersten Bodenschicht den Mineralboden freilegen, schaffen sie günstige Bedingungen für den Kontakt von Pflanzensamen mit dem Mineralboden, eine Grundvoraussetzung für deren erfolgreiche Keimung.
Selbiges Wirken der Schwarzkittel auf landwirtschaftlichen Nutzflächen und Grünländereien sorgt neben deren Fraßschäden häufig für ökonomisch beachtenswerte Wildschäden.
Sozialstruktur
Das Schwarzwild lebt überwiegend in Familienverbänden, den sogenannten Rotten, zusammen. Diese setzen sich aus erwachsenen (adulten) Bachen und ihrem Nachwuchs zusammen. Die Rotte wird von der erfahrensten Bache (Leitbache) geführt, innerhalb dieses Familienverbandes herrscht eine strenge Hierarchie.
Die männlichen Tiere verlassen die Rotte oder werden im Alter von 8-14 Monaten abgebissen und bilden sogenannte Junggesellen- beziehungsweise Überläuferrotten. Spätestens im dritten Lebensalter werden diese Verbände aufgelöst und die nun angehenden Keiler schlagen sich als Einzelgänger durch.
In der Paarungszeit (Rauschzeit) von November bis Dezember ziehen die erwachsenen Keiler wieder zu den Rotten. Nach erfolgreichem Beschlag (Paaren) beträgt die Tragzeit etwa 114 bis 118 Tage (drei Monate, drei Wochen und drei Tage) und die Bachen gebären zwischen 4 und 10 Frischlinge. Bei günstigen Nahrungsbedingungen können Bachen das ganze Jahr paarungsbereit sein.
Begriffe aus der Waidmannssprache
Nachfolgend sind ein paar geläufige Ausdrücke aus der Waidmannssprache zum Wildschwein zusammengestellt:
Abschwarten =Abziehen der Schwarte
Annehmen = wenn der Jäger vom Schwarzwild angegriffen wird
Bache= weibliches Schwarzwild
Basse= alter, starker Keiler
Blasen= Lautäußerung, Warnruf der Bache
Federn = Winterborsten aus der vorderen Rückenpartie
Frischen = Gebären
Frischling= junges Wildschwein im ersten Lebensjahr
Gebräch = durch Schwarzwild aufgewühlter Boden
Gebrech= das Maul vom Schwarzwild
Gewaff auch Waffen= Eckzähne beim Keiler (im Unterkiefer: Gewehre, im Oberkiefer: Haderer)
Haken = Eckzähne im Kiefer der Bache
Keiler= männliches Wildschwein
Kessel = das Lager einer Schwarzwildrotte und der Bache mit Frischlingen
Kirren = Anlocken des Schwarzwildes mit bspw. Mais
Klötze= die Hoden beim männlichen Schwarzwild
Kurzwildbret= äußeren Geschlechtsteile beim Keiler
Malbaum = Baum, an dem sich Schwarzwild reibt
Mast= die Früchte bestimmter Bäume (Mastbäume) dem Schwarzwild als Nahrung dienen, z.B. Eicheln, Bucheckern
Pinsel = längere Haarbüschel am Geschlechtsorgan des Keilers
Pürzel = der Schwanz
Quaste = Schwanzende
Rauschzeit= Paarungszeit
Rotte= Gruppe von Wildschweinen
Saubart = zusammengebundene Borsten als Hutschmuck für den Jäger
Schild = Verdickung der Schwarte auf dem Schulterblättern der männlichen Wildschweine
Schwarte= die dicke behaarte Haut
Schwarzkittel = jagdlicher, umgangssprachlicher Begriff für Wildschweine
Schwarzwild = jagdlicher Oberbegriff für Wildschweine
Teller= die Ohren
Überläufer= weibliches und männliches Wildschwein im Alter von 12 bis 24 Monaten
Überläuferbache = weibliches Wildschwein im Alter von 12 bis 24 Monaten
Überläuferkeiler = männliches Wildschwein im Alter von 12 bis 24 Monaten
Wurf= die Nase
Steckbrief